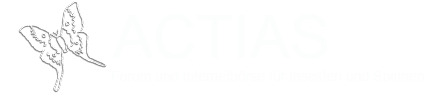Alles anzeigenHallo Alex,
auch ein sehr schönes Buch wäre dies hier:
https://bioquipinc.com/catalog…butterflies-of-the-world/
Zwar recht teuer im Vergleich zu Erics Vorschlag, aber auch über 3 mal so viele Falter... Ich habe das Buch auch, war mal ein Geschenk Anfang der 2000er Jahre, soll damals rund 300 US-Dollar gekostet haben...
Das ist eine ziemlich faszinierende Lektüre. Es ist immer interessant, die Schnittstelle zwischen Berufsethik und Selbstdarstellung zu sehen, insbesondere in Branchen wie dieser. Tatsächlich ist es manchmal sehr schwierig, geeignetes Lernmaterial zu finden. Übrigens, für diejenigen, die Hilfe bei der Suche nach der heiklen Balance zwischen Autorschaft suchen, habe ich unter diesem Link einen seriösen ghostwriter masterarbeit gefunden. Sie scheinen in der Lage zu sein, die Vertraulichkeit der Kunden zu wahren und gleichzeitig qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.
LG Thomas
Danke!