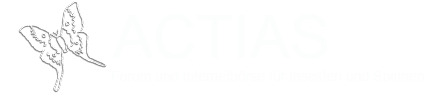Jetzt die Themen, die ich für recht wichtig und teils relevant für das Verständnis in der Praxis finde, bzw. was vor Ort konkret nachzuvollziehen ist.
Wichtige Faktoren sind die Besiedelbarkeit von Gebieten (Vorhandensein der Futterpflanzen und Habitate) und die Fähigkeit von Tagfaltern mehrere Generationen innerhalb eines Jahres auszubilden (1-3 bzw. x), sowie die Flugkünste der Arten und damit verbunden, sich sehr schnell oder sehr langsam auszubreiten.
Zudem ist eine nur sehr lokal verbreitete Art gefährdet durch genetische Verarmung, da bspw. eine Einwanderung genetisch variabler Individuen derselben Art kurzfristig bzw. langfristig ausbleibt. Damit einher geht, dass weniger Eier gelegt werden, schlüpfen und evtl. auch eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheiten.
Weitere Ursachen für eine lokale Isolation können sein: ein Wegfall der Raupenfutterpflanzen aufgrund Habitataufgabe durch neue Pflegenutzung, Dezimierung der Raupenfutterpflanzen, Veränderung klimatischer Komponenten, generell Sukzession für bspw. Niederwaldarten, Wetterereignisse (Regensommer, Dürresommer) die insbesondere auf Arten Auswirkungen haben könnten, welche eine sehr kurze Falterphase von ca. 14 Tagen aufweisen, wie dem Pflaumen-Zipfelfalter (Satyrium pruni). Dessen männliche Falter bei mangelnder Sonneneinstrahlung möglicherweise Probleme in der Erlangung der Fortpflanzungsfähigkeit und deren Weibchen bei der Eiablage haben könnten (vgl. eigene Beobachtung zu Callophrys rubi, Plebejus idas).
Möglicherweise haben wiederum bestimmte Arten keine schlechten Jahre und der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Eiablage ist eine Langlebigkeit und das Vorhandensein von Raupenfutterpflanzen (Lebensdauer Nierenfleck-Zipfelfalter: ca. 45 Tage).
Arten, die als Raupe überwintern sind zudem anfällig gegenüber Austrocknung, Schimmelbildung. Diese haben weniger das Problem bzgl. einer terminierten Kurzlebigkeit, schnell Eier abzulegen, dafür aber über einen sehr langen Zeitraum durchzuhalten, wobei der Bereich wohl schwer zu beurteilen ist.
Um mal ein Beispiel dafür zu geben, welches das überwinternde Stadium von einem Großteil der Tagfalterarten ist bzw. das hauptsächlich vorhandene Entwicklungsstadium, dass selten das Stadium des Imagos ist:
Ei: 15, Raupe: 92, Puppe: 24, Falter: 7
Zusätzlich besitzen die Männchen der Tagfalter ein spezifischen Verhalten bei der Weibchensuche. So schlüpfen bspw. die Falter des Baumweißlings (Aporia crataegi) etwas früher als die Weibchen (andro bzw. umgekehrt gyn irgendwas) und patroullieren, um ein frisch geschlüpftes Weibchen zu finden. Andere Arten wie der Segelfalter (Iphiclides podalirius), Schwalbenschwanz (Papilio machaon) (hill topping) und der Große Eisvogel (Limenitis populi) (tree topping) verwenden äußerst spezifische Muster bei der Partnersuche und brauchen diese rein theoretisch.
Zusätzlich brauchen alle männlichen Tagfalter laut Theorie für die Erlangung der Fortpflanzungsfähigkeit besonders xerotherme Bereiche bzw. Bereiche mit Hitzewallungen (Störstellen, sandige Flächen, Steine, Schotter). Beim Ginster-Bläuling (Plebejus idas) und Grünen Zipfelfalter (Callophrys rubi) konnte ich zudem praktisch ermitteln, dass die Ablage der Weibchen zentral von der Besonnung bzw. Hitzewallungen begünstigt wird und sich deutlich bereits bei einzelnen stärker schattenbildenden Wolken vor der Sonne verlängert (wobei hierbei auch manchmal zusätzlich Wind aufkam wegen Abstrahlung erhitzter Flächen bei einsetztender Bewölkung, stärker bei länger anhaltender Bewölkung). Grund ist hierbei vermutlich die Form des Eies (platt anstatt längs wie bspw. bei Zitronenfalter) und die bessere Verflüssigung dessen zur vereinfachten bzw. weniger energieintensiven Eiablage, insbesondere bei terminierter Anzahl an nahe gelegenen Nektarpflanzen. Die Weibchen beider Arten stimulieren dabei zusätzlich den Hinterleib durch ein Aneinanderreiben der Flügel.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist das kontinuierliche Vorhandensein von Nektarpflanzen und anderen Quellen (Honigtau, Pfützen, Kot, Mineralien).
Arten wie die Schillerfalter brauchen u.a. Mineralien aus Kot für die Erlangung der Fortpflanzungsfähigkeit, evtl. reichen auch Pfützen, weswegen vermutlich hauptsächlich Männchen an den Quellen angetroffen werden können und Arten bzw. Weibchen ohne Blütenbesuch und Pfützen leben wahrscheinlich von Honigtau und Baumwunden.
Zudem produzieren krautige Pflanzen während der Blüte unterschiedlich viel Nektar und Pollen. Eine Pflanze, die viel Nektar produziert, stellt demnach quasi in Mengen Billigmaterial (Wasser und Zucker) zur Verfügung, um anzulocken. Stark duftende Blüten produzieren demnach sehr viel Nektar (z.B. Dost, Thymian, Lavendel), was aber evtl. nicht bedeutet, dass gute Nektarpflanzen immer duften bzw. gut Locken.
Lavendel ist ein super Nektarlieferant, aber als Pollenlieferant wiederum eher schlecht, da er auf stickstoffarmem Boden nicht genügend DNA für die Pollenerzeugung zur Verfügung hat (vgl. Link). Er kann hauptsächlich nur auf Photosynthese setzen und duftet daher bspw. bereits nach einem kleinem Regenguss (Gießkanne) sehr stark und bei langer Dürre schwach. Er dient daher Bienen hauptsächlich nur für Honig (Nektar/Honig), weniger für Nachkommen („teures“ Stickstoff im Gelée Royale zum Zellenaufbau) (Stichwort: Bienentrachtpflanzen)
Ich kenne bisher keine ausführliche Seite, wo man recherchieren könnte, welche Pflanzen besonders viel Nektar pro Fläche produzieren und welche eher Pollen bzw. beides produzieren. Hier sind aber schon einige aufgeführt.
Link: https://www.bienenroute.de/trachtpflanzen
Hier mal die ergiebigsten Pflanzen bzw. Quellen, die ich in der Praxis mit Falterbesuchen erleben konnte:
Kleines Habichtskraut, Graukresse (Günsel, Sal-Weide, Mirabelle) (Frühling);
Berg-Sandglöckchen, Dost, Sand-Grasnelke, Gewöhnlicher Natternkopf, Flockenblume, Luzerne, Skabiose, Thymian, Acker-Kratzdistel, Lavendel, Kot, Wasserpfützen (Wasserdost, Turmkraut, Rotklee, Hornklee, Vogelwicke, Margerite) (Sommer);
Herbst-Aster, Heidekraut, Thymian (Herbst)
Meist findet man die Pflanzen auf sandigem Boden, Störflächen bzw. nicht zu stark bewachsenen Flächen, da dort eine Nicht-Verdrängung durch andere Pflanzen gewährleistet ist (vgl. Bild „Berg-Sandglöckchen (Jasione montana)“).
Allerdings gibt es auch Daten zur Bevorzugung bestimmter Blütenfarben für Falter (z.B. Schwalbenschwanz – Papilio machaon blau,lila,rot), im Schnitt setzen sich dabei die dunkleren Farben durch und gelb liegt glaube ich eher hinten.
Die mengenmäßig häufigsten Tagfalter, die an den Blüten angetroffen werden können sind Gräser fressende Tagfalterarten wie das Große Ochsenauge (Maniola jurtina) oder die Braun-Dickkopffalter (Thymelicus lineola und sylvestris), sowie der Rostfarbige Dickkopffalter (Ochlodes sylvanus).
![]()