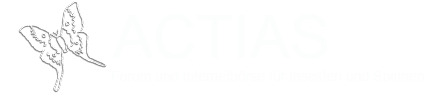So, wie immer hat das alles länger gedauert als gedacht, aber ich bin mal dazu gekommen Informationen zu den Weiden zu sortieren. Da es ja durchaus Interesse daran zu geben schien etwas mehr über die Bestimmung von Pflanzen zu lernen, werde ich an dieser Stelle immer mal ein paar Gruppen vorstellen. Das wird wahrscheinlich eher unregelmäßig erfolgen und keinem speziellen Muster folgen. Ich picke mir einfach mal Gruppen raus von denen ich sehe dass sie oft nicht bis zur Art bestimmt werden, wo die Bestimmung aber im Feld relativ leicht möglich ist und die häufig von Schmetterlingsarten genutzte Pflanzen sind. Zeichnungen liefere ich teilweise noch nach, wenn die Blätter ausgereift sind und ich wieder Ansichtsexemplare sammeln kann. Da man die Unterschiede aber selbst gesehen haben muss und es auch einige Wiederholung erfordert um die Merkmale überhaupt zu sehen und zu verstehen sei aber nochmal an gute Bildersammlungen und Bestimmungsschlüssel verwiesen (z.B. www.blumeninschwaben.de) und der Aufruf gestartet selbst rauszugehen und sich an einigen Pflanzen zu versuchen. Falls einige botanische Begriffe nicht geläufig sind gerne nachfragen oder vieles lässt sich schnell im Internet finden (z.B. eine relativ ausführliche Liste zu Blattmerkmalen auf Wikipedia). Die Definitionen sind allerdings nicht immer ganz einheitlich.
Kritik, Anregungen, Vorschläge, Wünsche zu Artengruppen die abgehandelt werden sollen oder Diskussionsbedarf würde ich bitten in den anderen Thread auszulagern, damit das hier nicht so unübersichtlich wird. Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht, mir macht es auch mehr Spaß zu diskutieren als einen Monolog zu halten.
Grüße Dennis